Tschou, Fredi
Als Alfred Maurer vor zwanzig Jahren bei Surprise anfing, hatte er selbst gerade einen Absturz hinter sich. Nun geht er in Pension, und mit ihm eines der Urgesteine der Strassenzeitungsbewegung.
 Von Mark Aurel, römischer Kaiser aus dem 2. Jahrhundert, stammt der Spruch: «Scher dich allein um das, was in deiner Macht steht – was du nicht beeinflussen kannst, kann dir gestohlen bleiben». Dahinter steckt die Idee der «Ataraxia», der Seelenruhe, wie schon die alten Griechen das nannten: eine innere Unerschütterlichkeit allen Widrigkeiten des Lebens gegenüber, ein Gefühl der unzerstörbaren Ruhe und Zufriedenheit.
Von Mark Aurel, römischer Kaiser aus dem 2. Jahrhundert, stammt der Spruch: «Scher dich allein um das, was in deiner Macht steht – was du nicht beeinflussen kannst, kann dir gestohlen bleiben». Dahinter steckt die Idee der «Ataraxia», der Seelenruhe, wie schon die alten Griechen das nannten: eine innere Unerschütterlichkeit allen Widrigkeiten des Lebens gegenüber, ein Gefühl der unzerstörbaren Ruhe und Zufriedenheit.
Schon klar, das klingt so abgedroschen wie diese autosuggestiven Merksprüche, welche unter gestressten Manager*innen herumgereicht werden, oder die an den Kühlschranktüren von uns Normalos hängen: «Sei ruhig und gelassen, geh deinen Weg», «Geduld ist meine Stärke, Gelassenheit mein Schwert».
Und doch gibt es sie, Menschen mit Ataraxia. Bruder Bashir, Mönch eines Klosters in Jerusalem, ist so einer; auch XhiXhi, eine Pizzaiola in Bözingen bei Biel, hat Seelenruhe den ganzen Tag, und wohl auch der Dalai Lama, wer weiss das schon.
Fredi Maurer jedenfalls hat sie – und wie er Ataraxia hat! Wenn er, zum Beispiel, die Lippen zu einem ganz dünnen Strich zusammenzieht und dabei lächelt, während er aus seinem Leben berichtet, viel Abenteuer war das und auch Tragödie, dann weiss man: Diesem Fredi kann keiner was.
Erste Jeans und erste Liebe
Seit exakt zwanzig Jahren arbeitet Fredi Maurer bei Surprise in Bern, im Dezember geht er in Rente. Und fast muss man sich quälen, um sich vorzustellen, wie das sein wird ohne ihn, so eng sind Fredi und Surprise. Dabei zog er früher mal mit Orientteppichen durchs Land. Zu diesem Job kam er über einen Kumpel, der in einem Berner Teppichladen die Lehre machte. Klingt gut, dachte der 17-jährige Maurer, das will ich auch. Zwar wäre er lieber Grafiker geworden, immerhin hatte Maurer in der Schule einen Zeichnungswettbewerb gewonnen. Für die Kunstschule hätte er aber in die Sek müssen, und daraus wurde nichts. Im Französisch war er kein Hirsch und der Musikunterricht – do re mi fa so lala – hat ihm gestunken. Aber im Sport war Maurer Kanone, Mannschaftskapitän plus «Fussballer des Kantons Bern» im Drippeln, Jonglieren und Penaltyschiessen, oder wie er selber sagt: «Schnell war ich nicht, technisch aber hatte ich was drauf.»
Maurers Kindheit? Arm, aber unbeschwert. Der Vater ein Hilfsarbeiter und Abwart, die Mutter Hausfrau, beide mit grossem Herz. Bis zu seinem siebzehnten Lebensjahr schläft Fredi mit den Eltern in einem Zimmer, so eng ist es daheim. Schulfreunde nach Hause nehmen, das wäre ihm peinlich gewesen. Dafür können sie als Kinder rumstreunern am Abend und an den freien Tagen, so lange sie wollen – Maurers Familie wohnt inzwischen in Bümpliz –, sie bauen sich Hüttchen im Wald, machen Feuer, spielen Streiche.
Mit dreizehn beginnt Maurer die Bücher aus Vaters Gestell zu lesen, «Im Westen nichts Neues», ein Antikriegsroman von Erich Maria Remarque, dazu die Werke des jüdisch-polnischen Schriftstellers Leon Uris, sie handeln vom Warschauer Ghetto und dem Nahostkonflikt – keine leichte Kost. Und es wird geschätzelet. Die erste grosse Liebe mit sechzehn, sie heisst Erika. Maurer lernt sie beim Tanz im Berner Mattequartier kennen. Und mit ihr die Welt des Films, denn Erikas Mutter, alleinerziehend und auf jeden Rappen angewiesen, arbeitet abends im Kino an der Kasse. Weswegen Fredi und seine Holde entweder sturmfrei haben oder umsonst Filme schauen können, beides super.
Noch ein wichtiges Ereignis aus jener Zeit: Maurers erste Jeans, erstanden in einem Secondhand-Laden – was egal ist, Hauptsache, er ist jetzt bei den coolen Leuten. Das i-Tüpfelchen obendrauf: ein Sachs Monark 2-Gänger, Maurers erster Töff, kein Heuler zwar, aber man kann das Teil gehörig frisieren. Als er mit siebzehn die Stifti beim Teppichhändler beginnt, reicht es bald für ein Maxi, das ist eine andere Liga – und, welch Freiheit, für eine eigene Mansarde.
Nach der Lehre arbeitet Maurer in einem Teppichgeschäft, dort lernt er Stoffe beurteilen, Muster, Knoten und Farben, er übt von der Pike auf die Kunst der Kundenberatung, eine Schule fürs Leben, wie sich noch zeigen soll. Und Maurer wird richtig gut darin, einer, der es mit den Leuten kann. Schon bald verkauft er mit links die teuersten Stücke, 75 000 für diesen Teppich, werter Herr, ein Schnäppchen, schlagen Sie zu!

Wird es nach der Pension finanziell allzu eng, trennt sich Fredi – schweren Herzens – vom einen oder andern Teppich. Foto: Klaus Petrus
Aber dann, nach fünf Jahren im Winter 1985/86, ist Schluss mit dem ständigen Lächeln im Gesicht und der Krawatte um den Hals. Maurer wird es eng, er muss weg aus Bern, diesem Dorf, und hinaus in die weite Welt, er ist Mitte zwanzig, kratzt das Ersparte zusammen, will was erleben! Erst DDR, dann Griechenland, dann Indien, Sri Lanka, Malaysia, Singapur, Burma, Nepal, die Insel Penang, eine richtig grosse Reise.
Das wäre wahrlich Stoff für «1001 Nacht», so ein fantastischer Erzähler ist dieser Mann. Seine Reiseabenteuer im Zeitraffer: servieren in schummrigen Bars, auf Feldern schuften, sich in eine Französin verlieben (die in einem Leichenwagen rumfährt, Edelsteine kauft und sie als Ringe vertickt), weltbestes Gras rauchen, den Teufel austreiben, sich in Geduld üben, Freundschaft mit assyrischen Flüchtlingen knüpfen, auf Goa (wie könnte es auch anders sein) die lauschigen Nächte durchschwofen, Unerhörtem Gehör schenken, Schildkröten beim Ausschlüpfen zuschauen, von Heimweh keinen Deut spüren, sich im Dschungel verlaufen plus zwei, drei Dinge, von denen Maurer mit grossem Amüsement erzählt, die er aber, schade eigentlich, hier nicht lesen möchte. Nach einem Jahr ist es Zeit, zurückzukehren ins Leben, in die Schweiz, nach Bern Bümpliz. Doch Maurer findet den Tritt nicht. Hat keine Arbeit, fühlt sich die ganze Zeit schlapp. Wird schon wieder, denkt er sich. Um Geld zu verdienen, geht er den Beizen nach, verkauft Ringe, so hat er das von der Französin gelernt. Und er kann ja gut mit Leuten. Samstags handelt er die Ware auf dem Flohmi, da sagt einer zu ihm, hock mal ab, du bist doch krank, hast den Gilb? Und endlich geht Maurer, der zähe Hund, zum Arzt. Da sind die Leberwerte längst im Keller. Gelbsucht, diagnostiziert der Doktor und verordnet ihm drei Monate Kur.
Familie statt Fernreise
Wieder auf den Beinen, hat Maurer einen Job bei Dunhill, Zigaretten verkaufen im Aussendienst, zwanzig Verkaufsplätze am Tag, vor allem Kiosks und Lebensmittelgeschäfte. Oft ist der talentierte Händler schon am frühen Nami seine Ware los. Dann setzt er sich in den «Löwen» Bümpliz, berüchtigtste Kifferbeiz weit und breit. Dort lernt er über zwei Tische hinweg seine Künftige kennen. Dazu Maurer im Rückblick: «Sie war eine Wilde, die Barbara, oh ja. Lebte zwei Jahre in London, gehörte dort zur Hausbesetzerszene. Und konnte richtig gut Billard spielen.»
Es ist 1989 und Maurer hat genug von Zigaretten, er kündigt, will wieder auf Reisen, am liebsten mit der Liebsten ab nach Asien. Da wird Barbara schwanger. Also Planänderung, es läuten die Hochzeitsglocken und Maurer bekommt eine Anstellung als Handelsvertreter beim wichtigsten Teppichproduzenten im Lande. Verdienst: bis 100 000 im Jahr plus Provision plus 42 Franken Spesen pro Tag («Die habe ich eingesteckt, ich nahm mir von daheim Sandwiches mit»), dazu ein Firmenauto der Marke Volvo 240 Kombi, dazu eine Firmenwohnung mit viereinhalb Zimmern in Kirchberg, wohin die frisch Vermählten ziehen und wo bald darauf ihr Sohn zur Welt kommt.

Fredi Maurer lernte im Teppichgeschäft Stoffe beurteilen, Muster, Knoten und Farben. Und er lernte die Kundenberatung – eine Schule fürs Leben. Foto: Klaus Petrus
Und plötzlich allein
Nur, der wilden Barbara wird es langweilig in diesem Kirchberg, 5000-Seelen-Dorf mit Frauenverein, Feldschützen, einer Kirche und einem Pub. Derweil ihr Mann Tag für Tag im Auto zu seinen Kunden kurvt, mal nach Andermatt, mal nach Pfäffikon, Fribourg oder Zermatt, oft übernachtet er in Hotels. In den nächsten Jahren kommen so, Maurer hat es nachgerechnet, eine Million Kilometer zusammen, alles südlich der A1.
Und ja, da habe man sich mit der Zeit halt auseinandergelebt, wie das so ist, sagt Maurer und wiegt den Kopf. Frau und Kind kehren nach Bern zurück, 1997 lässt sich das Paar scheiden. Wie sehr ihn das mitgenommen hat, regelrecht runtergezogen, lässt sich erahnen, wenn er, der Seelenruhige, einen Satz sagt wie: «Und dann war ich plötzlich allein.»
Keine Familie mehr, eine leere Wohnung, einer, der in der Arbeit aufgeht, plus ein Pub im Dorf – es kam, wie es oft kommen muss. Erst trinkt Maurer nur abends, aber viel, dann auch tagsüber und viel zu viel. Als sich das Leergut bei ihm auftürmt, steigt er von Bier auf Wodka um. Den kann er, ob Kaffee oder Cola, überall reinschütten und keiner riecht was. Irgendwann wird aus Schlucken eine Flasche und mehr pro Tag, da arbeitet Maurer längst nur noch stundenweise, wenn überhaupt. Die Rapporte seiner Kundenfahrten füllt er von zuhause aus, der Wagen steht in der Garage.
Dreiviertel Jahr geht das so. Dann fliegt der Teppichverkäufer auf und wird per sofort freigestellt. Und der Absturz nimmt seinen Lauf. Zurück in Bümpliz, sozusagen auf Feld 1, ist Maurer, er geht gegen die vierzig zu, die nächsten zwei Jahre ohne Job, er kann die Alimente nicht zahlen, lebt von der Sozere, hat den Anschiss. Gerade noch Familienidyll im Grünen, ein ordentlicher Zapfen und allseits gefragter Teppichkenner, und jetzt das ganz tiefe Loch – wie sich das anfühlte, was es bei ihm auslöste und so weiter, will der Reporter wissen und bohrt nach. «Natürlich hatte ich mich geschämt, wegen der Trinkerei und allem», sagt Maurer bloss, und genauso milde fügt er hinzu: «Aber eben.» 2001 macht Maurer den Entzug; heute nennt er sich einen Genusstrinker, der, das muss hier erwähnt sein, weil so poetisch, den wohligen Geruch von Granatapfeltee fast genauso mag wie das Bittere eines Biers.
Es ist Mai 2005: Nachdem Maurer die vergangenen Jahre in einem Projekt der Sozialhilfe gelernt hat, wie man aus Chiantiflaschen, wenn man sie richtig aufschneidet, kunstvoll designte Trinkgläser, Vasen, Schüsseln und Schälchen macht, bleibt er jetzt an einem Inserat des Vereins Surprise hängen: «Vertriebsleiter mit sozialem Gespür in Bern gesucht». Will heissen: Einer, der den Verkäufer*innen des Magazins unter die Arme greift, ihnen zuredet, der ein bisschen mit Computern kann und auch mit Buchhaltung, der Abrechnungen schreibt, Heftbestellungen aufnimmt, neue Verkaufsstandorte ausfindig macht, der mit viel Geschick und noch mehr Geduld mit Discountern, Gemeinden und Behörden verhandelt und und und.
Viel Büez also. Dabei geht das Gerücht um, die von Surprise würden einen lausigen Lohn zahlen. Was sich bestätigt. Doch Maurer ist das egal, er holt die Bundfaltenhosen aus dem Schrank, fährt nach Basel zum Bewerbungsgespräch und sagt ganz nebenbei, er wolle mit fünfzig sowieso keinen Ferrari fahren.
Prompt bekommt er den Job. Maurer schickt sich drein, er engagiert sich, setzt sich für die Verkaufenden ein. Ein manches Mal macht er Krankenbesuche, wenn ein Verkäufer – oft wegen Suchtproblemen – ins Spital muss. Obschon er versucht, Geschäft und Privates möglichst auseinanderzuhalten, durchlebt er mit ihnen Freuden und Qualen. Er mag diese Ungebügelten, Sperrigen, Unerschrockenen. Vielleicht, weil er ja selber so einer ist, bestimmt sogar: «Ich bin ein Freak», sagt Maurer, lächelnd, die Lippen zu einem Strich gezogen.
Stolz auf heute 125 Verkäufer*innen in Bern
Auch kommt es vor, das Maurer samstags mit dem Velo einem Verkäufer zehn zusätzliche Hefte mitbringt, weil doch am Nachmittag noch eine Demo ist und er findet, was für eine Chance! Überhaupt habe man damals das meiste Handgelenk mal Pi geregelt, direkter, unkomplizierter. Das Ziel: So viele Hefte wie nur möglich zu verkaufen, um den Leuten wenigstens ein kleines Auskommen zu ermöglichen. Als er 2005 mit dem Job anfing, gab es in Bern sechs Verkäufer und eine Verkäuferin; heute sind es, und darauf ist Maurer stolz, um die 125 und mehr als 500 in der ganzen Schweiz.
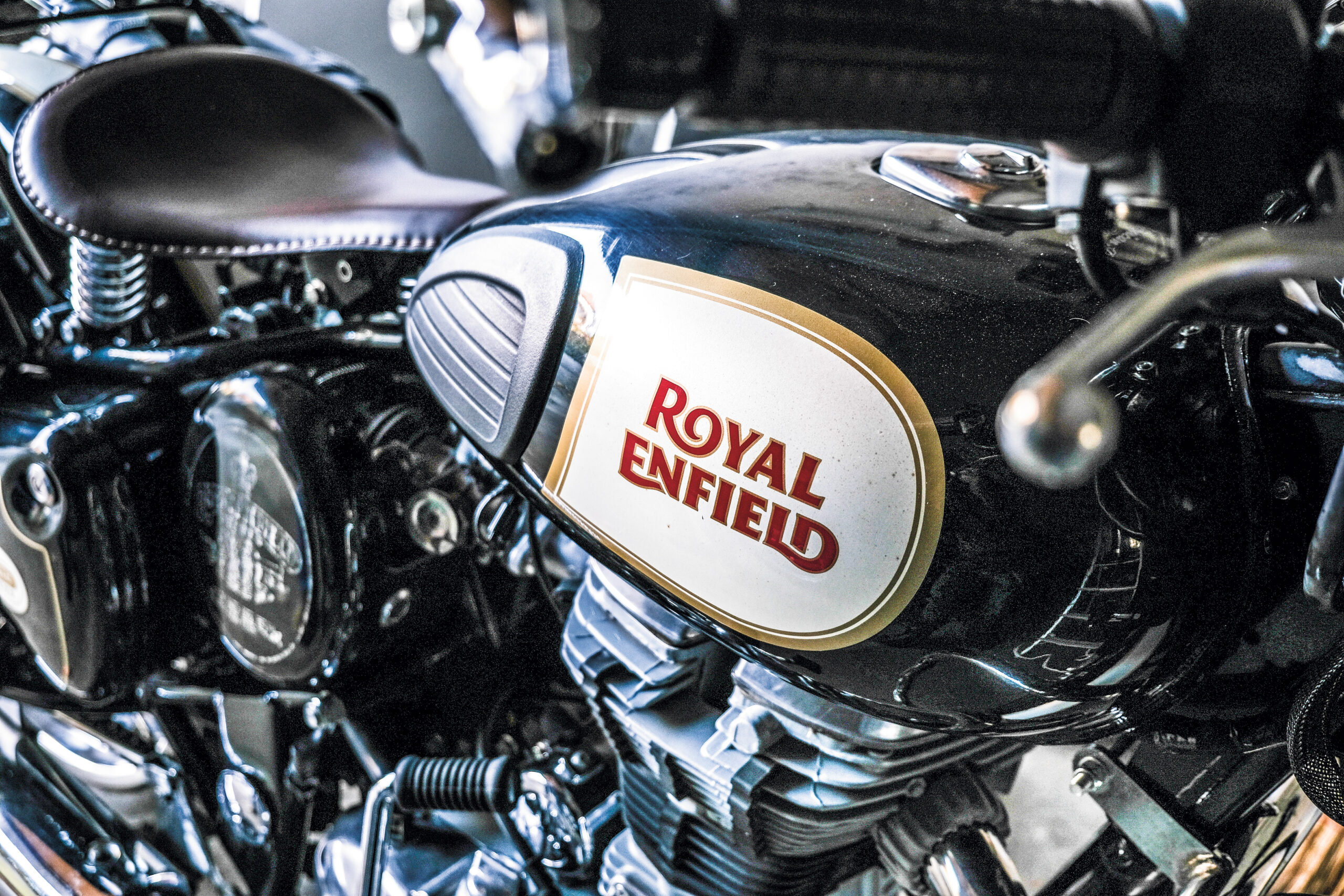
Die indische Royal Enfield aber bleibt in der Garage … Foto: Klaus Petrus
Der einstige Teppichverkäufer ist beliebt im Laden, damals wie heute. Weil er kein Laueri und Schnörri ist, sondern ein Macher, einer, auf den Verlass ist, der zuhören kann, der auch mal «jetzt aber!» knurrt, aber niemals nachtragend ist. Fragt man Weggefährt*innen von heute wie von einst, kommt ein Charakter zusammen, den man selber auch gerne haben möchte, jedenfalls unsereins: der eines sanften, den Menschen zugeneigten, lässigen Grandseigneurs. Ob es denn im Leben des Seelenruhigen nie Augenblicke von Angst und Bange gab? Oh doch, sagt Maurer und erzählt vom Winter 2010/11. Damals lag er, ein dünner Strich von 53 Kilo, wochenlang im Spital: Pankreas, die Beschwerden halten bis heute an. Er beantragte eine IV-Teilrente, musste lange auf den am Ende für ihn positiven Entscheid warten. Zu jener Zeit habe er schlaflose Nächte ohne Ende gehabt und auch Schiss, sagt Maurer, auf seinem Handy ertönte als Klingelton «Spiel mir das Lied vom Tod».
Im Spital beginnt ein neues Leben
Doch hat jedes Grauen auch sein Gutes. Im Spital lernt Maurer Angela kennen, die in den Neunzigerjahren mit ihrer Familie vor dem Krieg aus Bosnien in die Schweiz fliehen musste. Auch sie eine vom Leben geprüfte und liegt voller Schrauben und Metallplatten vor der siebten Rücken-OP im Krankenbett drei Etagen über Fredi. «Wachst du auf, werde ich da sein», sagt dieser zu ihr, und Angela ergibt sich entspannt der Narkose. Anderntags ist es um die beiden geschehen, sie sind bis heute ein Paar.
Was noch? Einen wie Maurer fragen, wie es sein wird im Dezember, wenn er hochoffiziell in Rente geht? Seine Antwort: «Dann wird der Wecker am Morgen nicht mehr läuten.» Vielleicht werde er in ein Loch fallen, jenu, vielleicht auch nicht. Sorgen um die Zukunft? Die Welt spiele verrückt, sie werde regiert von lauter aufgeblasenen Egos, nicht zu glauben sei das! Maurer schüttelt den Kopf, hält ein Weilchen inne. Über seine Nachfolge bei Surprise dagegen mache er sich keine Gedanken, alles paletti in Bern, die Leute da würden den Laden auch ohne ihn schmeissen. Nur dürfe man ob aller Sozialarbeit den Vertrieb und Verkauf nicht vergessen, denn am Ende sei die Rechnung eine ganz, ganz einfache, gibt Maurer zu bedenken: «Mehr verkaufte Hefte gleich mehr Unterstützung für unsere Leute. Deshalb um alte Standplätze kämpfen und neue dazugewinnen. Das war vor zwanzig Jahren so, und so ist es heute.»
Für ihn selber wird es finanziell eng werden in den kommenden Jahren, das weiss Maurer. Und zitiert, freilich mit einem Schmunzeln, den Kalenderspruch «Weniger ist mehr». Sich verschmälern, nennt er das: Ein paar Teppiche verkaufen (schweren Herzens zwar), einige Raritäten, am Ende alles, worauf einer wie er verzichten kann. Nur, um Himmelsgottwillen, den Töff nicht, richtigerweise: das Motorrad, eine Royal Enfield Bullet 500 aus Indien. Die bleibt, solange er aufs Ross steigen kann. Und wenn alle Stricke reissen (was Stricke selten tun), so sagt Maurer, «gehe ich halt Surprise verkaufen».
